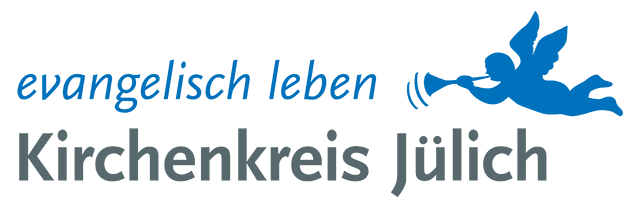

Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens,
dass ich liebe, wo man hasst;
dass ich verzeihe, wo man beleidigt;
dass ich verbinde, wo Streit ist;
dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist;
dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht;
dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält;
dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert;
dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt.
Herr, lass mich trachten,
nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste;
nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe;
nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe.
Denn wer sich hingibt, der empfängt;
wer sich selbst vergisst, der findet;
wer verzeiht, dem wird verziehen;
und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben
Franz von Assisi zugeschrieben
Kontakt:
Peter-Beier-Haus
Aachener Straße 13 a
52428 Jülich
Telefon: 02461 9966-0
Fax: 02461 9966 29
E-Mail: eeb.juelich@ekir.de
Leitung:
Jean Jacques Badji
Mobil: 0170 5937755
E-Mail: jean.badji@ekir.de
Sekretariat:
Elke Reinartz
Sabine Mack-Bettge
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 9.00 - 12.00 Uhr
Di. u. Do. 14.00 - 15.30 Uhr

